Kaliwerk Merkers
Die Ursprünge des heutigen Werksstandortes Merkers im gleichnamigen Ortsteil der Krayenberggemeinde (Thüringen) reichen in die letzten drei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts zurück. Bereits 1876 wurden auf der Suche nach Steinsalz Bohrungen im Dorf Kaiseroda niedergebracht. 1881 kam es zu weiteren, erfolgreichen Bohrungen und 1893 wurde als Ergebnis der Bohrtätigkeit in Kaiseroda ein Kalilager nachgewiesen. Ein Jahr später (1894) wurde die Gewerkschaft „Kaiseroda“ gegründet und 1895 mit dem Teufen des Schachtes Kaiseroda I in Hämbach begonnen. Im Jahr 1901 hat das Werk Kaiseroda – nachdem die erforderlichen Übertageanlagen errichtet und die Endteufe im Schacht 1 erreicht waren – seinen Betrieb aufgenommen. 1911 wurde das große Rad gedreht und es wurden damals gleich zwei Schächte, Kaiseroda II und III, geteuft, aus denen später das Werk Merkers hervorging.
Merkers – das Vorzeigewerk
Nach dem ersten Weltkrieg wurde die Fabrikanlage Kaiseroda I in Hämbach stillgelegt und abgebrochen (1921). Ein Paradebeispiel für die Rationalisierung in der Kaliindustrie und für den systematischen Ausbau moderner Produktionsverfahren war das neue Kaliwerk Kaiseroda II/III, das August Rosterg, die führende Unternehmerpersönlichkeit des Wintershall-Konzerns, seit 1923 in Merkers bauen ließ. Nach nur zwei Jahren Bauzeit war das Prestigeobjekt fertig: 1925 nahm die damals größte und modernste Kalifabrik der Welt ihren Betrieb auf und war bis 1945 das Vorzeigewerk der Wintershall-Gruppe. Die Fabrik war so leistungsfähig, dass sie neben dem eigenen, geförderten Rohsalz auch das von benachbarten Gruben verarbeiten konnte. Wenig später wurden die Kapazitäten durch den Bau von zwei Kaliumchlorid-Fabriken noch erweitert. Anfang der 1930er Jahre wurden in Merkers täglich 7.500 Tonnen Rohsalz gefördert. Das Werk Merkers war auch Vorreiter in der Verarbeitung von Nebenprodukten bei der Kaliherstellung, z.B. Bittersalz und Brom, für deren Herstellung in Merkers ausreichende Kapazitäten geschaffen worden waren. Darüber hinaus produzierte Wintershall in Merkers aus dem in großen Mengen als Kieserit anfallenden Rückstand Glaubersalz und deckte seitdem mehr als zwei Drittel des Glaubersalzbedarfs der deutschen Textil- und Zellulose-Industrie ab.
Starke Nachfrage nach Nebenerzeugnissen
Mit ihren hochwertigen Nebenerzeugnissen reagierte die Kaliindustrie nicht zuletzt darauf, dass die chemische Industrie, aber auch die Textil- und Zellulosehersteller diese Stoffe immer stärker nachfragten. Demgegenüber verloren die einfachen Kaliumchlorid-Dünger an Bedeutung. Auch die Landwirtschaft wurde zunehmend mit neuen Spezialdüngern beliefert. Das waren vor allem sulfatische Düngemittel, die weltweit nur im Werra-Revier aus dem geförderten Rohsalz hergestellt werden konnten.
Kriegsende & Goldschatz
Das weltgrößte Kaliwerk sorgte am Ende des zweiten Weltkriegs für Schlagzeilen. Bei ihrem Vormarsch in Deutschland erreichten die Spitzen der 90. US-Infanteriedivision das Kaliwerk Merkers. Die GI’s trafen dort nach Angaben der Geschichte der Division auf acht deutsche Zivilisten (u.a Werner Vieck. Deutsche Reichsbank, Berlin, Dr. Paul Ortwin Rave, Direktor der Berliner Nationalgalerie). Von diesen bekamen sie bereitwillig Auskunft über die unter Tage eingelagerten Geld- und Kunstschätze (100 Tonnen Gold, die gesamte Goldreserve des Deutschen Reiches, drei Milliarden Reichsmark, zwei Millionen US-Dollar, 110.000 britische Pfund, vier Millionen norwegische Kronen, eine Million französische Francs sowie zahlreiche Kunstgegenstände). Das in der Grube Merkers untergebrachte Sammlungsgut der Berliner Museen stammte aus 15 verschiedenen Abteilungen, einschließlich der Nationalgalerie. Es befanden sich dabei Gemälde aus dem 14. bis 20. Jahrhundert, die Mehrzahl sämtlicher in Berlin vorhandener Hauptwerke der deutschen und italienischen Plastik, die fast vollständige Sammlung des Kupferstichkabinetts, die Büste der Nofretete und der Welfenschatz.
Eine Woche später besuchte General Dwight D. Eisenhower, der Oberbefehlshaber der amerikanischen Truppen in Europa, mit den Generälen George S. Patton jr. und Omar Nelson Bradley die Grube Merkers und machte sich ein eigenes Bild von der ihm unversehens in die Hände gefallenen Beute. Am 16. April 1945 begannen die US-Truppen mit der Verladung des Reichsbankschatzes, nachdem über Merkers eine zweitägige Ausgangssperre verhängt worden war. In den darauffolgenden Wochen wurden auch die unterirdisch angelegten Depots mit Kunstschätzen und Akten wieder geräumt. Im Gegensatz zum Goldschatz, dessen Spur sich in Frankfurt am Main verliert, gelangten sie in einigen Fällen nach einer mehr oder weniger langen Odyssee wieder an ihre angestammten Plätze zurück.
Entwicklung des Werkes in der DDR
Nach Ende des 2. Weltkriegs und der Gründung der beiden deutschen Staaten im Jahr 1949 begann man in der DDR die bestehenden Kaliwerke und Bergbaubetriebe im sozialistischen Sinn umzubenennen. 1952 aus der Sowjetischen Aktiengesellschaft ausgegliedert wurde das frühere Werk Kaiseroda in Merkers 1953 in VEB Kaliwerk „Ernst Thälmann“ umbenannt. Das Werk in Merkers wie auch alle anderen Kaliwerke unterstranden der Hauptverwaltung Kali in Ost-Berlin, die 1956 ihren Sitz nach Erfurt verlegte. 1958 entstand aus ihr die Vereinigung Volkseigener Betriebe (VVB) Kali. Die ostdeutschen Kaliwerke an der Werra wurden im selben Jahr zum „VEB Kalikombinat Werra“ mit Sitz in Merkers zusammengeschlossen. 1970 erfolgte der Zusammenschluss der bisher volkseigenen Betriebe Südharz, Werra, Saale und Zielitz, die 13 Kali- und Steinsalzwerke Betrieben, im neu gegründeten VEB Kombinat Kali in Sondershausen.
Meilensteine in der Entwicklung des Werkes in der DDR waren ab 1966 die Umstellung der Gewinnung und Abbauförderung auf dieselgetriebene Bergbaugroßgeräte. 1974 war die Umstellung auf Bandförderung in der Grube Merkers abgeschlossen. Die neu gebaute Bromfabrik hat 1967 ihren Betrieb aufgenommen und 1978 wurde ein neues Lösehaus in Betrieb genommen. Zudem wurde ein Wetterverbund, d.h. ein Verbund zur Frischluftversorgung und zum Lenken der Abwetter (verbrauchte Luft) aller Gruben der thüringischen Werke, realisiert mit dem erklärten Ziel, eine Verbesserung der Wetterführung der benachbarten Grube Unterbreizbach zu gewährleisten.
1980 wurde beim Aufschluss einer Sylvinitkuppe in 800 Meter Tiefe („Teufe“) die Kristallgrotte entdeckt – bis heute ein Herzstück des 1991 eröffneten Erlebnis Bergwerk Merkers.
Produktionsende & Stilllegung
1993 wurde im Juni das letzte Rohsalz aus der Grube Merkers über Schacht III gefördert. Es folgten die Stilllegung des Werkes und die Aufnahme von Sicherungsarbeiten. 1993 wurde auch mit dem Abriss der Übertageanlagen in Merkers ebenso wie in Dorndorf, Springen und Alexandershall (Berka) begonnen.
Karte
In der Nähe
| Kategorie | geoOrt |
|---|---|
| Verwahrung Grube Merkers Entfernung: 0.01 km von Kaliwerk Merkers | |
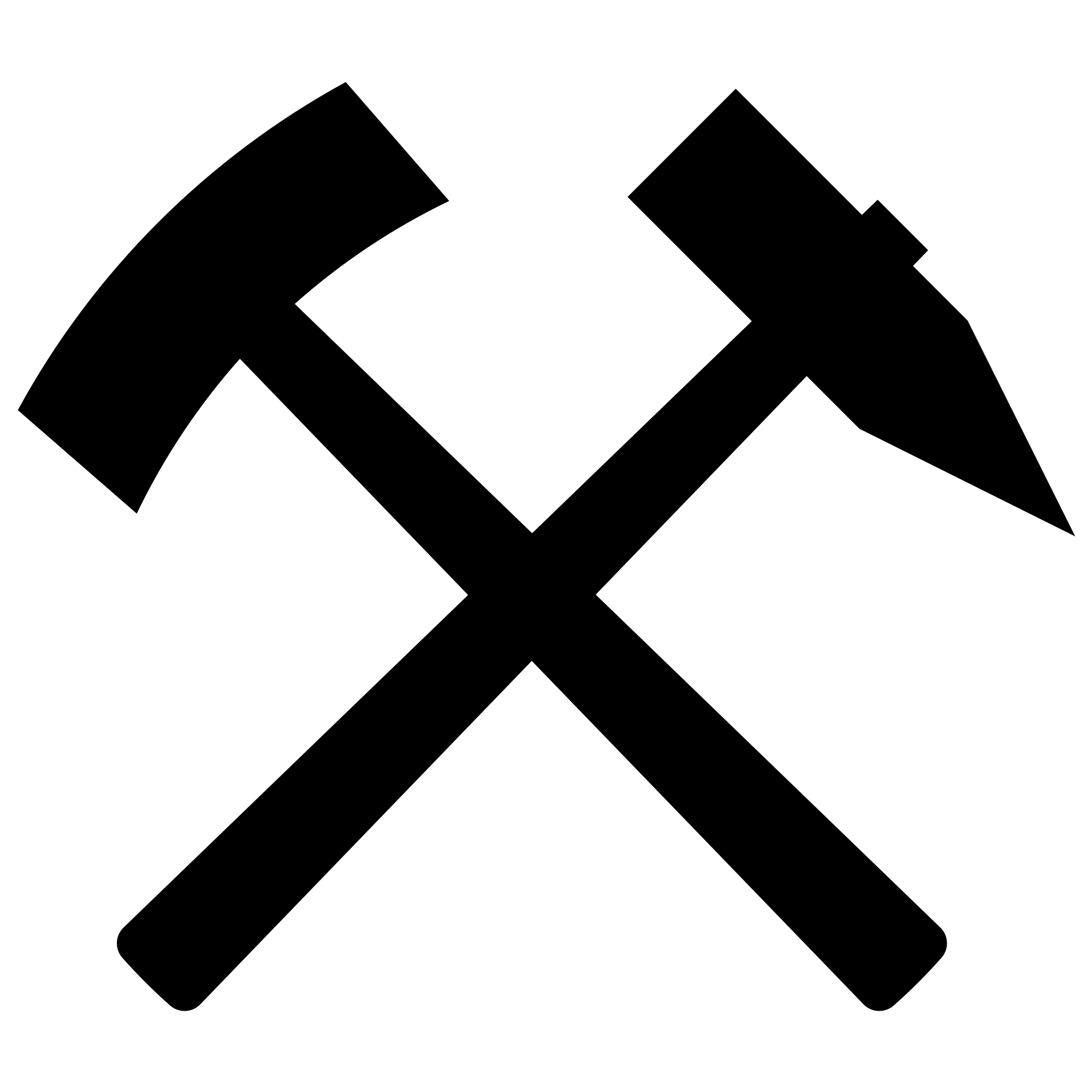 | Erlebnis Bergwerk Merkers (Schacht III) Entfernung: 0.06 km von Kaliwerk Merkers |
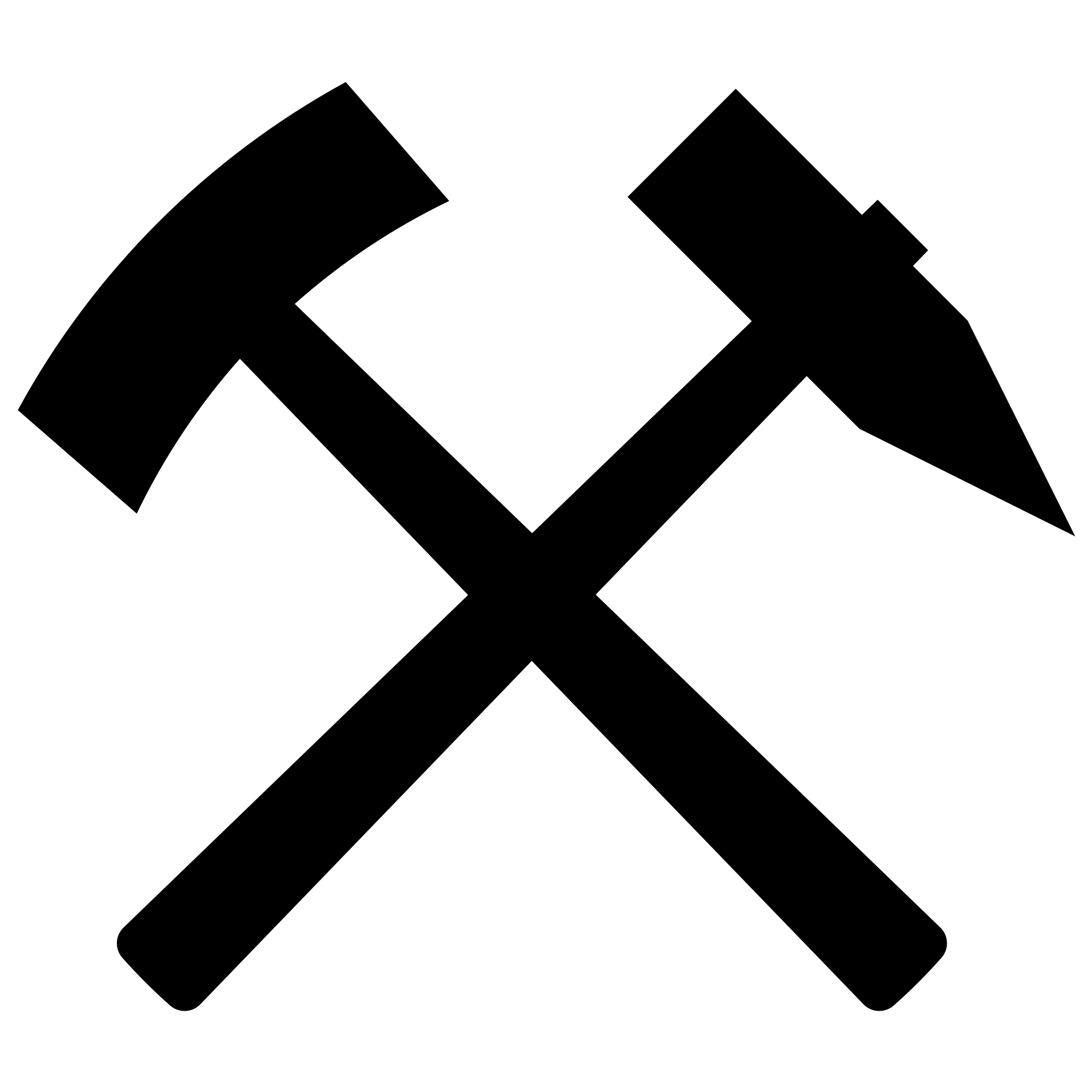 | Fabrikanlage Dorndorf Entfernung: 2.49 km von Kaliwerk Merkers |
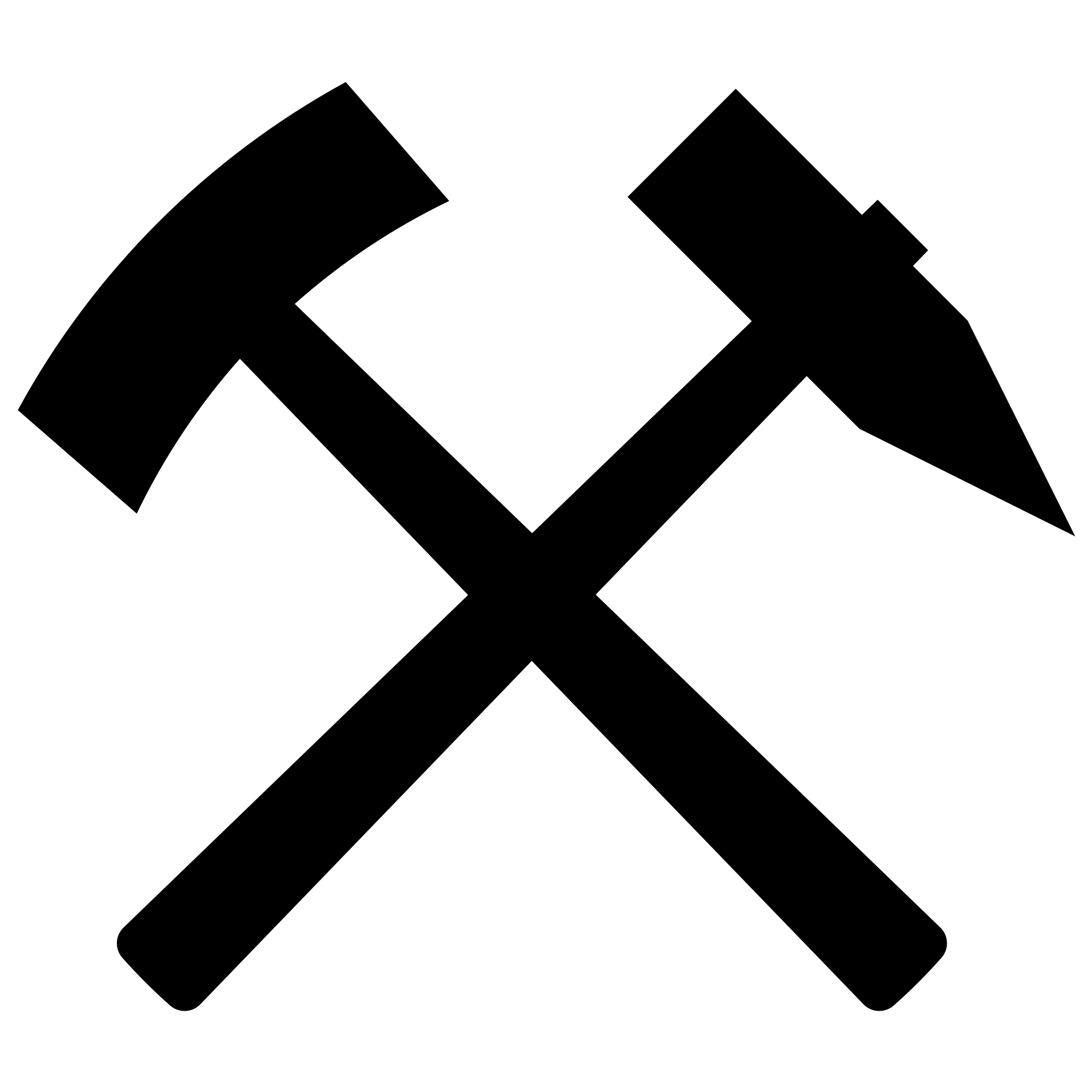 | Kaliwerk Großherzog von Sachsen (Dietlas) Entfernung: 2.5 km von Kaliwerk Merkers |
| Kaliwerk Kaiseroda I Entfernung: 2.7 km von Kaliwerk Merkers |
Werra-Kalibergbau-Museum
Das Werra-Kalibergbau-Museum in Heringen (Werra) dokumentiert die Geschichte und Gegenwart des seit 100 Jahren wichtigsten deutschen Kaliabbaugebiets auf beiden Seiten der hessisch-thüringischen Landesgrenze an der mittleren Werra. Der Ende des 19. Jahrhunderts beginnende Kalibergbau prägt die Region maßgeblich bis auf den heutigen Tag und ist nach wie vor der mit weitem Abstand größte Arbeitgeber.