Kaliwerk Großherzog von Sachsen (Dietlas)
In Dietlas – heute ein Ortsteil der Krayenberggemeinde – wurde im Jahr 1896 eine erste Erkundungsbohrung durchgeführt. Zwei Jahre später wurde mit dem Teufen des ersten Schachtes begonnen. Wegen starker Wasserzuflüsse im Plattendolomit musste das Verfahren nach KindChaudron angewendet werden, bei dem das nachlaufende Wasser in einem aufwändigen und langwierigen Verfahren abgepumpt wird. Damit begann für die kleine Rhön-Gemeinde das „Zeitalter“ der Industrialisierung. Im gleichen Jahr brannte das Magazin auf dem Werksgelände und im Jahr 1900 kam es im Sommer zu einem Wassereinbruch im Schacht Dietlas. Ende Juli besuchte der damalige Erbherzog Wilhelm-Ernst von Sachsen-Weimar (seit 1901 Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach; seit 1903 Großherzog von Sachsen – bis 1918) den frisch geteuften Schacht und wurde zum Namensgeber des Kaliwerkes.
1904 wurde das obere Kalilager bei 539 Meter Teufe erreicht. Am 2. Januar 1905 wurde über den Schacht Dietlas das erste Salz gefördert und ein Jahr später mit dem Bau einer knapp 3 Kilometer langen Drahtseilbahn (Luftseilbahn) zwischen Dietlas (Schacht Georg = „Großherzog von Sachsen I“) und der Kalifabrik in Dorndorf begonnen. Zeitgleich entstand die Kaliwohnsiedlung „Kolonie“ in Dietlas.
Perspektivisch war vorgesehen, unter Tage eine Verbindung mit dem Grubenfeld Menzengraben herzustellen, damit die Forderung eines zweiten Ausgangs erfüllt werden konnte. Denn die vor dem ersten Weltkrieg erlassene so genannte Zwei-Schacht-Verordnung verlangte, dass Kaliwerke aus Sicherheitsgründen über einen zweiten befahrbaren Schacht – den so genannten Polizeischacht – verfügen.
Stilllegung in den 1920er Jahren
Nach dem ersten Weltkrieg wollte man zur bergbaulichen Normalität zurückkehren, was nur bedingt funktionierte. Durch Absatzprobleme und damit verbundenen Produktionsrückgängen der deutschen Kaliwerke kam es auch in Dietlas zu Einschränkungen. Man begegnete dieser Entwicklung mit einem Produktionsstillstand in den Sommermonaten. Im Jahr 1924 kaufte der Wintershall-Konzern das Kaliwerk „Großherzog von Sachsen“ und legte es nach und nach vollständig still (bis 1926).
Im zweiten Weltkrieg verlegte die in Düsseldorf ansässige Maschinenbaufirma Hasenclever aufgrund der großen Zerstörungen der Fabriken und Anlagen durch die alliierten Bombenangriffe ihre Produktion nach Dietlas. Die Wintershall hatte durch die engen Geschäftsbeziehungen zu Hasenclever die leerstehenden Gebäude und Hallen des stillgelegten Kaliwerkes in Dietlas angeboten. Von da an produzierte Hasenclever dort Bergbaumaschinen für die umliegenden Kaliwerke.
Bergwerksmaschinen aus Dietlas
Nach Kriegsende 1945 hatte die neu gegründete SAG (Sowjetische Aktiengesellschaft) den Betrieb von Hasenclever übernommen. Am 11. März 1948 wurde mit der Gründung des SAG-Betriebes „Maschinen- und Reparaturwerk Dietlas“ der Grundstein für das spätere Werk „Bergwerksmaschinen Dietlas“ gelegt. 1952 erfolgte die Rückgabe des Betriebs an die DDR. Dietlas wurde volkseigener Betrieb und belieferte ab dem Beginn der 1960er Jahre die im Kalibergbau der DDR benötigten Geräte und Großmaschinen. Der Betrieb wurde in den Industriezweig Kaliindustrie eingegliedert und bekam einen neuen Namen („Diberma“).
Gebirgsschlag 1989
Kurz vor der Wende, im März 1989, hatte ein Gebirgsschlag übertätig zu großen Zerstörungen im Ort Völkershausen geführt. Aber auch Dietlas blieb nicht verschont: die Rhöngemeinde war durch Beschädigungen an der Bausubstanz der Gebäude betroffen. Der Schornstein des Heizhauses auf dem Betriebsgelände in Dietlas musste in der Folge sogar abgerissen werden.
Kurz nach der Wende musste das Werk seinen Betrieb einstellen, da die in der DDR verbliebenen Kali- und Steinsalzwerke die benötigten Maschinen nun von westdeutschen Herstellern bezogen. 1990 wurde das Kalikombinat aufgelöst und der Betrieb in Dietlas wurde in eine GmbH umgewandelt.
1993 erfolgte eine Zusammenlegung des Betriebes in Dietlas mit dem Maschinenhersteller MMU in Recklinghausen und fortan wurden raupenmobile und stationäre Backen- sowie Prallbrecheranlagen hergestellt. 1997 ging der Betrieb in Dietlas in Insolvenz. Der Freistaat Thüringen griff helfend unter die Arme und es wurde ein Neuanfang unter dem Namen BTZ ermöglicht. Ab 1998 wurden in der Betriebsstätte in Dietlas raupenmobile Backenbrecheranlagen sowie weitere Brecheranlagen und Bauschutt-Aufbereitungsanlagen gefertigt.
Endgültige Demontage 2012
Im Jahr 2005 verließ das Unternehmen den jahrzehntealten Standort in Dietlas und zog in das Gewerbegebiet von Merkers, wo es unter dem Namen BAT Bergbau- und Aufbereitungstechnik fertigte. Auf dem aufgegebenen Betriebsgelände in Dietlas wurden im Jahr 2012 die noch bestehenden Gebäude abgerissen und es wurde Platz gemacht für einen Solarpark, mit dessen Bau im November 2013 begonnen wurde. Gebaut wurde der Park in zwei Abschnitten (bis Ende Dezember 2013 und bis Ende Mai 2014) Die Nutzfläche hat eine Größe von etwa 6,6 ha.
Karte
In der Nähe
| Kategorie | geoOrt |
|---|---|
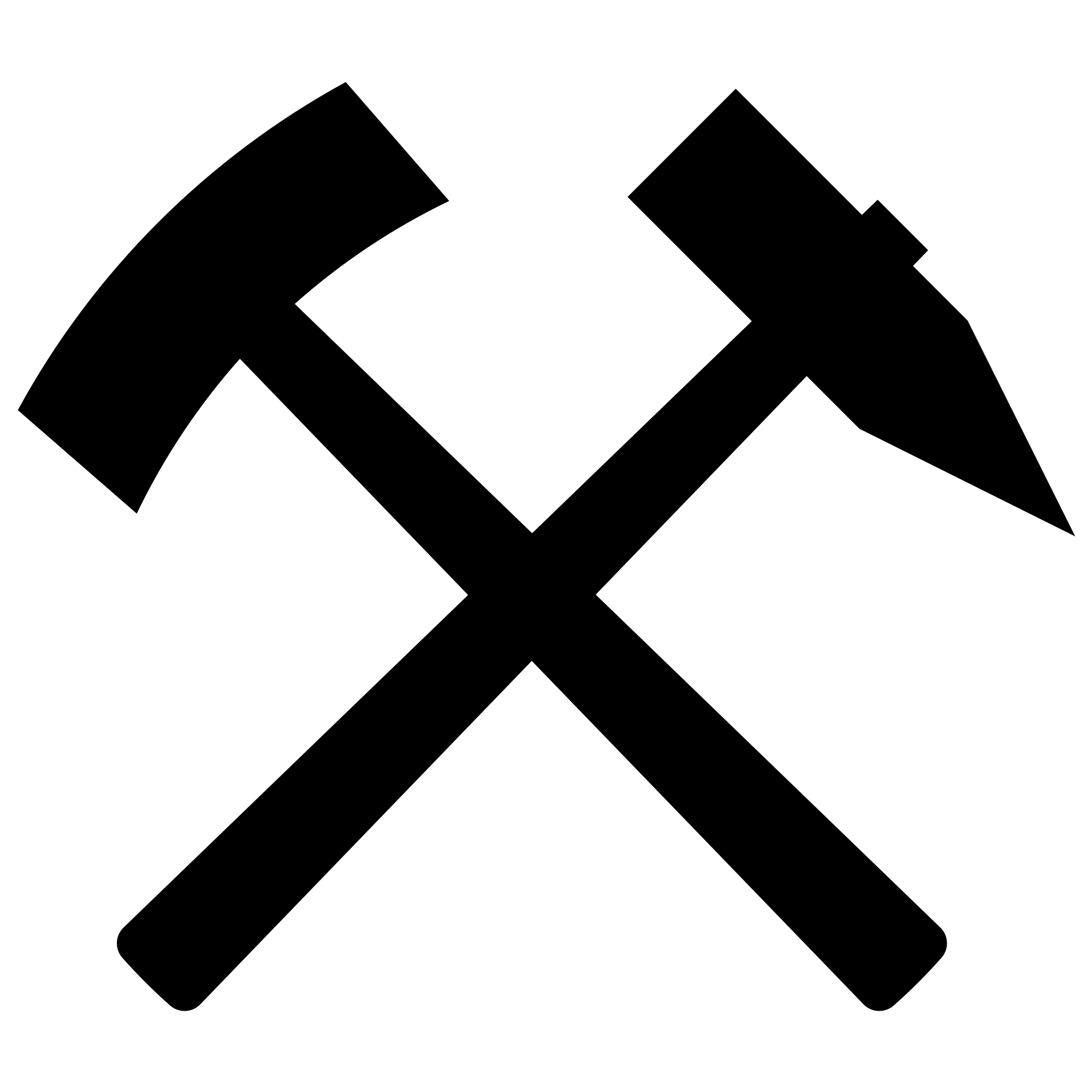 | Fabrikanlage Dorndorf Entfernung: 2.37 km von Kaliwerk Großherzog von Sachsen (Dietlas) |
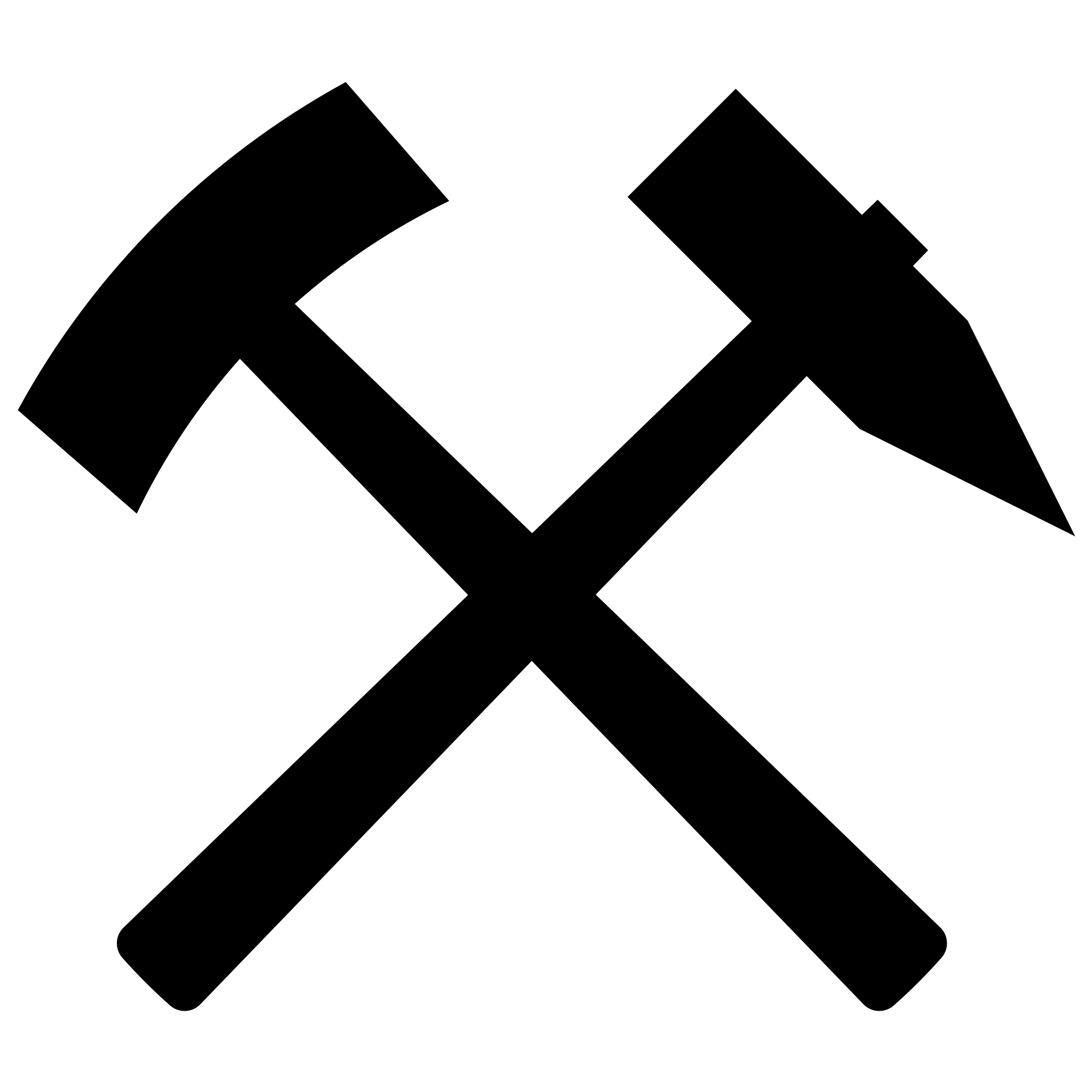 | Erlebnis Bergwerk Merkers (Schacht III) Entfernung: 2.44 km von Kaliwerk Großherzog von Sachsen (Dietlas) |
| Verwahrung Grube Merkers Entfernung: 2.5 km von Kaliwerk Großherzog von Sachsen (Dietlas) | |
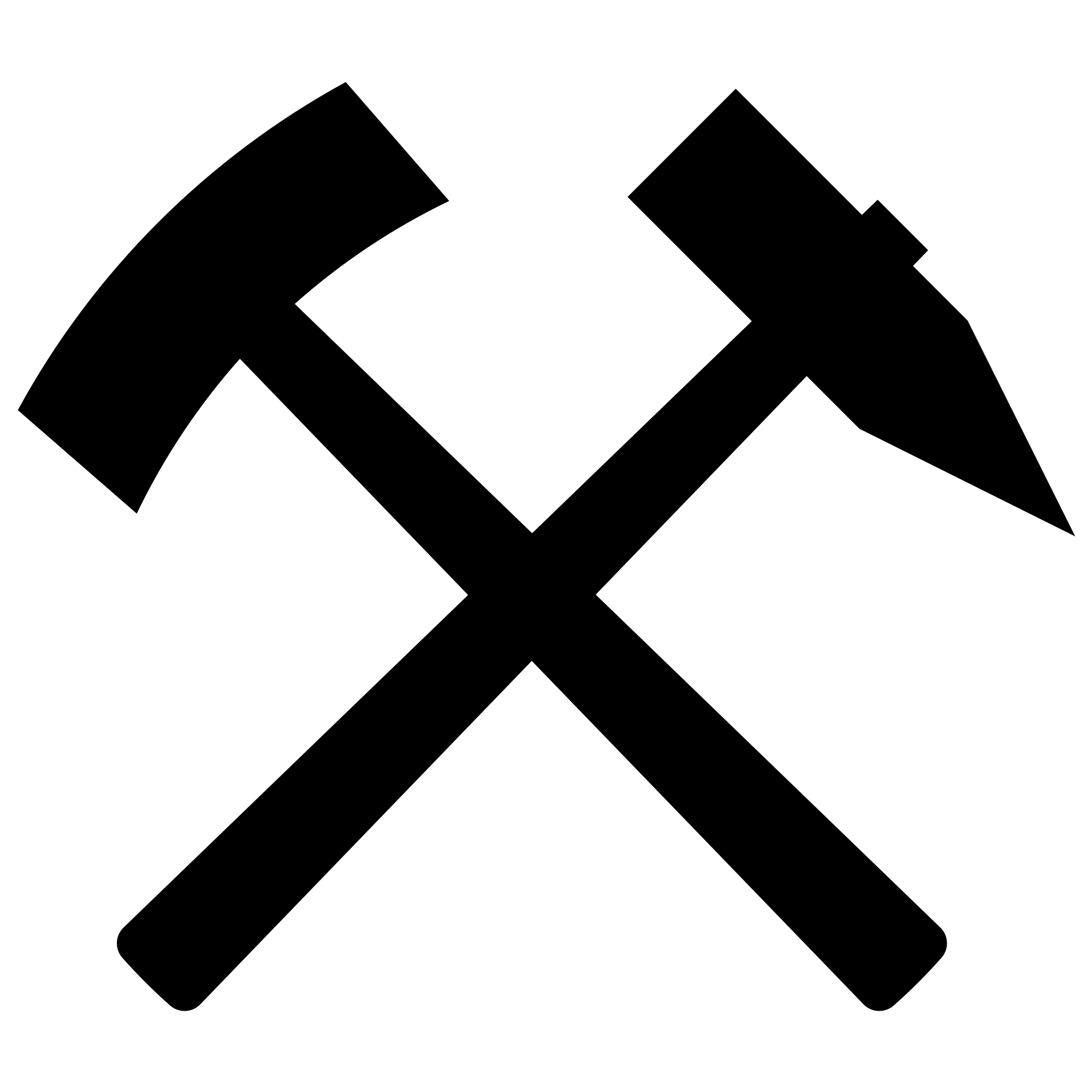 | Kaliwerk Merkers Entfernung: 2.5 km von Kaliwerk Großherzog von Sachsen (Dietlas) |
| Schachtanlage Menzengraben Entfernung: 2.65 km von Kaliwerk Großherzog von Sachsen (Dietlas) |
Werra-Kalibergbau-Museum
Das Werra-Kalibergbau-Museum in Heringen (Werra) dokumentiert die Geschichte und Gegenwart des seit 100 Jahren wichtigsten deutschen Kaliabbaugebiets auf beiden Seiten der hessisch-thüringischen Landesgrenze an der mittleren Werra. Der Ende des 19. Jahrhunderts beginnende Kalibergbau prägt die Region maßgeblich bis auf den heutigen Tag und ist nach wie vor der mit weitem Abstand größte Arbeitgeber.